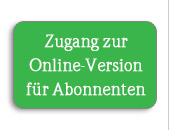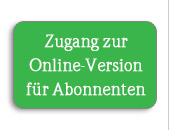archivierte
Ausgabe 5/2025 |

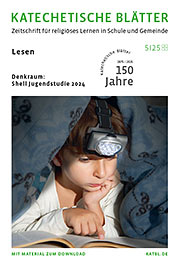
 |
       |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| Jean-Pierre Sterck-Degueldre |
| Bibel lesen ist wie Filme schauen |
| Die filmhermeneutische Bibeldidaktik bietet viele spannende Zugänge zu biblischen Texten, die Brücken zwischen der Lebenswelt der Lernenden und den Schriften des Neuen Testaments schlagen helfen – konkrete Beispiele für eine korrelative Erschließung des Markusevangeliums. |
 |
Eine mondäne Party im Garten einer prächtigen Villa. Der Gastgeber: Elton John. Angetrunken torkelt er zwischen den Gästen zum Swimmingpool. Stürzt hinein. Schwimmt bis zum Boden des Beckens, wo ein kleiner Junge mit Taucherglocke auf dem Kopf an einem Kinderpiano Eltons Hammerhit »The Rocket Man« spielt. Er ist es selbst als Kind. Beide singen im Duo. Gäste stürzen sich ins Schwimmbecken, um Elton John zu retten. Sie legen zugleich eine Unterwasser-Choreografie zum Song hin. Vom Erste-Hilfe-Team wird Elton John am Poolrand reanimiert und samt Notarzt ins Krankenhaus transportiert. Dort wird er von einem um ihn herumtanzenden Notfallteam versorgt und für den Bühnenauftritt fit gemacht: Von der Notaufnahme stolziert Elton John direkt auf die Konzertbühne vor ein jubelndes Publikum in einem vollen Stadion. Elton John singt, rockt am Klavier und schießt schließlich wie ein Raketenmann in den Himmel. Die Szenenabfolge, Schlag auf Schlag, dauert nur wenige Minuten – in Gänze von einer adaptierten Fassung des Songs »The Rocket Man« untermalt. Würde je ein Kinobesucher den Saal in der Überzeugung verlassen, dass Elton John unter Wasser singen oder gar in den Himmel aufsteigen kann? Ich hoffe nicht! Erinnert uns die letzte Szene an eine Episode im NT? Zu Recht! (Lk 24,51; Apg 1,9).
Das Genre Bio-Epos und die Evangelien
»The Rocket Man« bietet eine bio-epische Verfilmung (2019) der Karriere des jungen aufstrebenden britischen Popstars Elton John Mitte der 1970er Jahre. Das Bio-Epic ist mit fantastischen Elementen durchspickt und changiert an zentralen Stellen kunstvoll zum Musical. Dabei erhebt das beliebte Genre des Bio-Epic nicht den Anspruch, das Leben einer berühmten Persönlichkeit möglichst historisch getreu zu dokumentieren. Es ist ein Spielfilm, der dezidiert tendenziös erzählt und nicht objektiv berichtet. Was keineswegs pejorativ konnotiert ist: Es ist ein inszeniertes Schauspiel, das uns emotional mitreißen, die Person in ein bestimmtes Licht rücken möchte!
So vieles erinnert an die narrativen Inszenierungen in den Evangelien. Diese erheben ebenso wenig den Anspruch, das Leben Jesu möglichst faktentreu zu dokumentieren. Sie erzählen vielmehr den geglaubten Christus und lenken unseren Blick auf das, was sie uns von Jesus zeigen wollen. Den Kern bilden der historische Jesus, seine Lehre und sein Handeln, aber dieser begegnet uns in kunstvoll gestalteten Narrationen.
Filmhermeneutische Bibeldidaktik
Die gestalterische Arbeit biblischer Schriftsteller und heutiger Filmemacher sind gut vergleichbar: Was die einen in bewegten Bildern festhalten, inszenieren die anderen mit Worten – beide den Konventionen ihres Genres entsprechend. Heutige Bibelleser*innen können vom Medium Film vieles über die Machart der ihnen oftmals fremd anmutenden antiken Schriften lernen. Grundlegende Deutungskompetenzen liegen meist schon vor, sie brauchen nur vom Film auf die biblischen Texte übertragen zu werden. Einige didaktische Impulse für unterrichtliche Konkretionen seien hier exemplarisch anhand des Markusevangeliums »vorgeführt «.
Das Markusevangelium – filmhermeneutisch erschlossen
Evangelium und Vita
Als Markus um 70 n. Chr. als Erster eine Evangelienschrift verfasst, bedient er sich der Gattung »Vita«. Dieses in der römischen Antike wohlbekannte literarische Genre erzählt das Leben und Handeln einer Persönlichkeit, deren aktuelle Bedeutung für die Leser*innen erschlossen wird. Auch hier handelt es sich nicht um eine nüchterne Berichterstattung. Cicero z. B. fordert ein, dass ein wahrer Historiker um exornatio bemüht sein muss: die literarische Ausschmückung, damit den Leser*innen sich der Sinn der Geschichte erschließt (Cicero, de legibus I, 5). Aus den Fakten sollen nur die bedeutsamsten so erzählt werden, dass sie den Leser*innen Sinn spenden. Worte oder Reden werden den Protagonisten zu diesem Zweck auch gerne in den Mund gelegt. Der Evangelist Markus eifert diesem antiken Vorbild nach. Das antike biografische Genre erinnert in verblüffender Weise an das filmische Bio-Epos (s. das Lernvideo).
Historischer Jesus – erzählter Christus
Sicherlich ist Elton John keine reine Fiktion, sondern eine historische Person, die jedoch filmisch inszeniert und mitunter überhöht dargestellt wird. Der britische Schauspieler Taro Egerton und eben nicht Reginald Kenneth Dwight alias Sir Elton John ist im Film zu sehen. Die Filmemacher haben den Fokus auf einzelne Aspekte von Eltons Künstlerbiografie gesetzt: Material ausgewählt, anderes weggelassen. Kaum anders erzählen die Evangelisten über Jesus, den sie als Christus bekennen und als diesen inszenieren (s. die Lernvideos).
Trailer der Frohen Botschaft: Jesu Programm
Markus legt zu Beginn seiner Schrift (Mk 1,14–5) Jesus eine sog. programmatische Rede in den Mund: »Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!« Knapp, inhaltlich dicht wirkt die Stelle wie ein Filmtrailer: Wesentliches ist auf den Punkt gebracht. Die Stelle soll die Leser*innen mitreißen, ihnen helfen, in die Erzählung einzusteigen. Schüler*innen können zu Mk 1,14–15 einen Trailer entwerfen, was auch vorab eingeübt werden kann: Wie eine Information, einen Standpunkt oder gar das persönliche Lebensprogramm knapp und präzise auf den Punkt bringen? Die Lernenden formulieren knappe Statements (30 Sekunden, rund 50 Wörter), die anschließend als Audio-Podcast eingesprochen (Software z. B. Garage-Band, Audacity) oder auch mit Bildmaterial visualisiert werden können (z. B. VideoScribe, PowToon). Natürlich bedarf die Gestaltung eines Trailers zuvor einer inhaltlichen Auseinandersetzung: Die Begriffe Reich Gottes, Erfüllung der Zeit und Umkehr müssen zuerst inhaltlich erschlossen werden. Es kann auch Jesu Programmrede in heutige Sprache übertragen werden z. B. mit Blick auf soziale Spannungen, politische Gerechtigkeit, Frieden und Krieg. Wie würden heutige Leser* innen womöglich auf diese Botschaft reagieren?
Arme Schweine: Blick mit der Kamera
Die Lernenden versetzen sich in die Rolle eines Regisseurs und imaginieren Kameraperspektiven zu der äußerst kuriosen Wundererzählung in Mk 5,1–20 (Arbeitsblatt mit zwei Spalten: Text und parallel dazu leere Kästchen). Wie würden sie den Blick lenken? Wie lenkt die Erzählung unseren Blick? In den Fokus rücken die Inszenierung, die Aktanten, die Handlung. Die Übung verlangsamt und intensiviert die Lektüre: Schüler*innen nehmen unscheinbare Details wahr. Die Wundererzählung wird narrativ erschlossen. Historisch-kritische Fragestellungen stehen einstweilen hintenan. Etwas anspruchsvoller: Über das Zeichnen eines Storyboards zu einzelnen Szenen wird die Erzählung vertieft. Zugleich sensibilisieren diese Arbeitsschritte die Lernenden für eine zentrale historisch-kritische Erkenntnis: Der Exorzismus ist ein literarisches Kunstwerk, eine wohldurchdachte Inszenierung, also kein Tatsachenbericht.
Blick hinter die Kulissen: Mutmachgeschichten
Wie in Bonustracks zu einem Film hilft ein Blick hinter die Kulissen, die Machart von Mk 5,1–20 zu durchschauen. Diachrones Sachwissen zur Entstehung des Textes sowie hermeneutische Impulse, den kuriosen Text zu entschlüsseln, bieten Sachtexte z. B. zur Legio X Fretensis (Eber auf den Standarten), zum Dämonenglauben in der Antike (Exorzismus, papyri grecae magicae), zu jüdischen Vorstellungen von kultischer Unreinheit (das Grab, die Besessenheit, die Schweine usw.), zum jüdischen Krieg (Schlacht in Tarichäa, Rolle der Leg X F) oder auch das Interview (s. Lernvideo) mit dem Neutestamentler Martin Ebner, der Rede und Antwort steht: Mk 5,1–20 ist eine Hoffnungserzählung, eine Mutmachgeschichte. Unter den Bonustracks finden sich oft auch sogenannte »Outtakes«. Wie Filmemacher nicht alle Materialien verwerten, werden auch die Evangelisten eine Auswahl getroffen haben. Didaktische Ideen zur Arbeit mit solchen Leerstellen im Markustext als Outtakes finden sich im Downloadbereich.
Special effects
Das Evangelium wartet an vielen Stellen mit special effects auf, d. h. mit starken Bildern, die den Blick lenken, die Spannung steigern, die etwas realistisch zeigen, was es aber in Wirklichkeit so nicht gibt – z. B. auch in der Kreuzigungserzählung, wo eine Finsternis über das ganze Land einbricht und der Tempelvorhang entzweireißt (Mk 15,33.38): Lernende können solche starken Bilder ausfindig machen und deren Bedeutung eruieren.
Cliffhanger und eine zweite Staffel
Das Evangelium endet abrupt (Mk 16,1–8): Die Frauen finden das leere Grab vor, laufen vor Schrecken davon und erzählen niemandem davon. Wie soll es weitergehen? Was für ein Cliffhanger! Und ein mutiges Ende, das die antiken Leser*innen zurückverweist nach Galiläa, wo Jesus unterwegs war, gewirkt und gepredigt hat. Markus konfrontiert seine Adressat*innen mit der Frage: Wo ist Jesu Galiläa in eurem Leben? Wie folgt ihr Jesus konkret nach? Damit Jesu Auferstehung Früchte trägt, müssen wir Jesu Lehre vom Reich Gottes in unserem Leben säen. Lernende können imaginieren, wie die Erzählung weitergeht, damit Jesu Botschaft vom Reich Gottes auch heute Früchte trägt: eine oder mehrere neue Episoden zu einer neuen Staffel der Jesus-Nachfolge, die z. B. im Hier und Jetzt spielt.
Abspann
Dass die Kindheitserzählungen in Lk 1–2 und Mt 1–2 als Prequell zur markinischen Inszenierung gelesen werden können, dass es in vielen Evangelien-Episoden (wie z. B. in TV-Serien) Anspielungen zu anderen Episoden aus dem eigenen Werk oder aus dem Alten Testament gibt, dass sich hier und dort gar so etwas wie Schleichwerbung verbirgt, sei hier nur am Rande erwähnt. Die Praxiserprobung hat uns gezeigt: Die Vokabeln und Grammatik der Medienwelt hilft, Brücken zu schlagen in die Lebenswelt der Leser*innen heute. Korrelation ist keine »Mission Impossible«.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unsere neue Dienstleistung für Verlage, die ihr Abogeschäft in gute Hände geben wollen.
|

mehr
Informationen
|
 |
|
| Bücher & mehr |

|
|