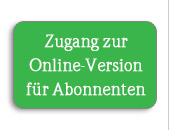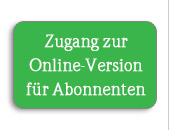archivierte
Ausgabe 4/2025 |

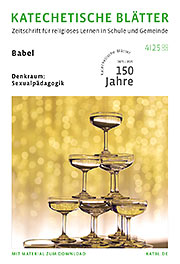
 |
       |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| Christopher Schmidt |
| Babylonische Sprach-Verwirrung bei den Comic-Helden |
| Sie kämpfen für Gerechtigkeit und retten die Notleidenden: die Superheld*innen aus den US-Comics der Verlage Marvel und DC Comics. Aber wussten Sie, dass Superman und Co. auch schon einer Kommunikationskrise von biblischem Ausmaß gegenüberstanden? |
 |
Spätestens seit den Kinofilmadaptionen bekannter US-Comics wie »Marvel’s The Avengers « (2012) gehören auch hierzulande die Helden mit übernatürlichen Kräften zum festen Personal kindlicher, jugendlicher und auch erwachsener Medienwelten – und das weit über das kleine Nischenpublikum der Comicleser* innen hinaus.
Im Sinne von Manfred L. Pirners medienweltorientierter Religionsdidaktik kann das Medienphänomen der Superheld*innen damit zum ertragreichen Gegenstand für das religiöse Lernen werden (Pirner 159–160). Aber was macht ein bestimmtes populäres Medium überhaupt interessant für religiöse Bildungsprozesse? Und sind alle Medien schon dadurch theologisch interessant, weil ein Element der religiösen Tradition wie der »Turmbau zu Babel « vorkommt?
Diesen Fragen möchte ich anhand der Reinszenierung der biblischen Turmbau-Perikope im Comic »JLA – Tower of Babel« (JLA #43–46) aus dem Jahr 2000 von Autor Mark Waid und Zeichner Howard Porter nachgehen und medienspezifisch darstellen.
Die religiöse Motivik der Superheld* innen
Comicfiguren und ihre Abenteuer in einen theologischen Kontext zu stellen, ist zunächst einmal kein neuartiger Blick auf die medialen Bezugspersonen aus den bunten Heftchen und es lässt sich auf eine überraschende Fülle an deutschsprachigen Veröffentlichungen verweisen – ausgehend von dem von Jutta Wermke schon 1976 herausgegebenen Sammelband »Comics und Religion. Eine interdisziplinäre Diskussion«. Seitdem wurden Superheld*innen in der theologischen Forschungsliteratur in erster Linie unter der Perspektive »moderne Mythen« auf ihre Funktion der Weltdeutung und den Ausdruck von Werthaltungen hin untersucht – mit all den religionssoziologischen Implikationen, die sich daraus ergeben.
Mit Nicolas Gaspers lässt sich sogar eine ganze Typologie an religiöser Motivik in der Superheld*innen-Mythologie entwerfen (Gaspers 21–35). Unsere Storyline »Tower of Babel « würde man anhand dieser Typologie im Feld der »(Re)Inszenierung religiöser Bilder und Symbole« ansiedeln. Dabei zeichnet sich diese Reinszenierung gerade durch die Nutzung der formalästhetisch-erzählerischen Eigenheiten des Mediums Comic aus, welche in der bisherigen theologischen Betrachtung bislang eher vernachlässigt wurden. Gerade das wäre aber das eigentliche Kriterium, um einen Gegenstand aus der Medienwelt für religiöses Lernen auszuwählen, nicht das bloße Vorkommen einer biblischen Anspielung. Eine ähnliche Akzentverschiebung hat übrigens Reinhold Zwick bereits in der theologischen Betrachtung von Spielfilmen angeregt, indem er die eigentliche religiöse Qualität des Films in den filmästhetischen Eigenheiten, wie Bildgestaltung und Montage, sowie dem Akt des Sehens selbst herausgestellt hat (Zwick 212– 213). Es wird für uns also zwingend notwendig, das Medium Comic ästhetisch und erzähltheoretisch zu durchdringen, bevor wir uns an eine theologische Deutung wagen können.
»Understanding Comics« – Wie Leser*innen Mythen schaffen
»Tower of Babel« macht auf die Einzigartigkeit des Erzählens und Verstehens des Mediums Comic selbst aufmerksam, was den eigentlich religionsproduktiven Prozess populärer Medien darstellt und noch dazu in verblüffender Übereinstimmung mit den Themen der biblischen Perikope steht.
Ohne nun aufwendig mit der Erzähltheorie des Comics zu konfrontieren, orientiere ich mich beispielhaft im Folgenden an einem einzigen Diktum aus dem Standardwerk »Understanding Comics. The Invisible Art«, in dem Autor Scott McCloud etwas sehr Interessantes zum Lesefluss von Panel zu Panel – also den vielen Einzelbildern, aus denen sich eine Comicseite zusammensetzt – bemerkt:
»Comics panels fracture both time and space, offering a jagged staccato rhythm of unconnected moments. But closure allows us to connect these moments and mentally construct a continuous, unified reality« (McCloud 67).
Damit bestehen Comics in McClouds Deutung aus Fragmenten, Momentaufnahmen und Differenzen, die isoliert betrachtet nicht wirklich viel Sinn ergeben. Erst die Rezeption der Leser* innen (bei McCloud interessanterweise als »closure«, also der Beendigung von Ambiguität im psychologischen Sinne, bezeichnet) lässt die vielen Einzelbilder zu einer sinnstiftenden Erzählung werden, erst durch das Zutun der Leser*innen bekommen die Charaktere ihre Dynamik, entwickeln Beziehungen zueinander und kommen miteinander ins Gespräch. Der Mythos des Superheld*innen-Kosmos entsteht, angeregt durch die formale Besonderheit des sequenziellen Erzählens, letztlich erst in der aktiven Rezeption der Leser*innen. Damit erweist sich schon der Vorgang des Comic-Lesens als Sinnsuche in einer auf den ersten Blick zerstückelten Welt.
You’ll have to Aruh Nokka Vbl … – Batman? Batman, you’re speaking nonsense!
Aber was wäre, wenn die Sinnsuche im Medium nicht mehr funktioniert? Wenn Wonder Woman nicht mehr versteht, was Batman ihr sagen möchte, und die Leser*innen an ihre Grenzen stoßen, wenn es darum geht, die Welt des Comics beim Lesen mit Gehalt zu füllen?
Dieser babylonischen Lese-Verwirrung geht die Storyline »JLA – Tower of Babel« nach und reinszeniert den Gegenstand der biblischen Tradition als Geschichte der Zerstreuung, Isolation und gestörten Kommunikation mit den für Comics typischen Gestaltungsmitteln auf zwei Ebenen – zum einen innerhalb der Handlung und zum anderen bei den Lesenden selbst:
Öko-Terrorist Ra’s Al Ghul will seine lang gehegten Pläne, die Menschheit zu dezimieren, um der geschädigten Umwelt eine Chance auf Erholung zu bieten, endlich in die Tat umsetzen. Für sein Ziel, die Zivilisation in ihrer Entwicklung zurückzuwerfen, wendet der Comic- Bösewicht eine biblisch inspirierte Strategie an und maßt sich die Rolle des strafenden Gottes an: Er entwickelt ein Gerät, das mit Schallwellen die Sprachfähigkeit der Menschen weltweit beeinträchtigt. Erst ergibt das geschriebene Wort keinen Sinn mehr und Warnhinweise, Patientenakten oder Computerprogramme können nicht mehr gelesen werden. Die Folge ist ein globales Chaos, das die Menschheitsfamilie an den Rand eines Atomkrieges bringt.
Als die JLA (Justice League of America) einschreitet, kommt es noch schlimmer: Auch die verbale Kommunikation wird unmöglich und ganz konsequent erscheint für die Leser*innen nur noch ein unsinniger Wortsalat in den Sprechblasen. Der Angriff auf die Kommunikation der Justice League stellt damit auch einen Angriff auf die Leser*innen dar, wirft diese wieder zurück in eine fragmentarisch-zerklüftete Welt und führt eindrucksvoll vor Augen, welche essenzielle Rolle Sprache und ihr Verständnis in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und unserer Weltdeutung spielen.
Und wie die Comicfiguren gemeinsam mit den Leser*innen aus der Isolation herauskommen, ist ebenso vielsagend dargestellt: Kein anderer als das sonst so vereinsamte Alien Martian Manhunter schafft es, mit seinen telepathischen Kräften eine gedankliche Verbindung zwischen den Mitgliedern der Justice League herzustellen. Im Zuge dessen erscheint auch für die Leser*innen wieder ein sinnvoller Dialog in Form von Denkblasen statt Sprechblasen, um die Geschichte zu ihrem Abschluss zu bringen. Während unsere Helden es letztlich schaffen, die Welt zu retten, erschaffen die Leser*innen einen Mythos, der von der Bedeutung der Sprache und der Kommunikation mit anderen für die Erschließung der Welt und für das gemeinsame Leben in ihr erzählt.
Was »Tower of Babel« zum geeigneten Gegenstand für die medienweltorientierte Religionsdidaktik macht, ist nicht der religiös konnotierte Titel, sondern die transzendierende Erfahrung des Lesens selbst, hervorgehoben durch die erzählerischen Besonderheiten des Comics.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unsere neue Dienstleistung für Verlage, die ihr Abogeschäft in gute Hände geben wollen.
|

mehr
Informationen
|
 |
|
| Bücher & mehr |

|
|