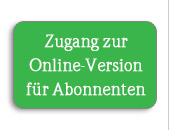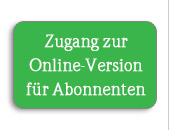archivierte
Ausgabe 3/2025 |

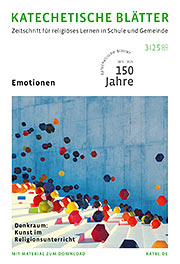
 |
       |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| David Novakovits |
| Fürchtet euch nicht, »Generation Angst«!? |
| Es gibt einfachere Aufgaben, als sich mit Ängsten auseinanderzusetzen. Und doch
ist ein Wahrnehmen, Verstehen und Bearbeiten verschiedener Formen der Angst
von zentraler Bedeutung für die Gestaltung von Selbst- und Weltverhältnissen
von Menschen – und damit eine wichtige Verantwortung und Aufgabe von
Schule.
Der Beitrag untersucht die Möglichkeiten des Religionsunterrichts in
diesem Kontext. |
 |
Ein kleiner 8-jähriger Junge sitzt zwischen seinen Eltern im dunklen Kino; auf der Leinwand eine dramatisch-schreckliche Szene (eines Zugunglückes), die selbst Erwachsene im Saal erschaudern lässt. Bei der Heimfahrt im Auto: Der Junge mit weit aufgerissenen Augen, stumm; die Eltern werfen sich vieldeutige Blicke zu – »wir hätten uns den Film wohl zuerst selbst ansehen sollen«. In den nächsten Tagen wird der Junge jedoch von einer Art Leidenschaft gepackt; er stellt die furchteinflößende Szene aus dem Film immer und immer wieder mithilfe seiner Modelleisenbahn nach. In Kleinarbeit filmt er einzelne Ausschnitte der Szenerie, schneidet sie zusammen und sieht sich den dabei entstandenen Film mit seiner Mutter gemeinsam an.
Diese Szene entstammt dem autobiografisch geprägten Werk »The Fabelmans« (2023), in welcher Steven Spielberg seine eigene Geschichte in einen Film übersetzt. Glaubt man dem Regisseur, dann war es eine Erfahrung von Angst, die am Beginn seines kreativen Schaffens stand – oder präziser: die (glückliche) Fähigkeit, eine bestimmte, scheinbar traumatische Angsterfahrung kreativ verarbeiten zu können. Angsterfahrungen müssen bearbeitet werden, um Menschen aus der schockhaften Versteinerung zu lösen – und gleichzeitig scheint Spielberg zeigen zu wollen, dass eine wahre Auseinandersetzung mit Ängsten mehr sein kann als nur das. Ist Schule, ist der Religionsunterricht jedoch der richtige Ort für solche »emotionalen« Bildungsprozesse? Der Beitrag möchte einige Gedanken vorstellen, die dabei helfen sollen, in dieser Frage zu einem Urteil zu kommen.
Angst – in der Schule?
»Man könnte (…) meinen, dass für Heranwachsende nichts peinlicher ist, als im Kontext einer Gruppenerfahrung mit Gleichaltrigen – wie beispielsweise im Klassenzimmer mit seinen Mitschüler*innen – nach seinen Gefühlen gefragt zu werden und diese im Sinne von ›echten‹ Gefühlen zur Sprache zu bringen« (Naurath 210). Dem ist wohl nichts hinzuzufügen. ›Reden wir einmal über unsere Ängste‹ – so unvermittelt und direkt eingeleitet ist das wohl das denkmöglichste Worst-Case-Szenario eines Religionsunterrichts schlechthin. Ebenso klar ist, dass der Religionsunterricht kein Therapieort ist. Und dennoch: »Wie sehr wir von den Dingen der Welt betroffen sein mögen, wie tief sie uns anregen und erregen mögen, menschlich werden sie für uns erst, wenn wir sie mit unseresgleichen besprechen können« (Arendt 77).
Ausgehend von diesem Gedanken Hannah Arendts wird deutlich, dass Schulen eine Verantwortung dafür tragen, Lernen nicht rein kognitiv auszurichten, sondern den Bildungsgehalt aller Dimensionen von Selbst- und Weltbeziehungen der Menschen anzuerkennen, die eben »kognitive und emotionale Aspekte umfass[en], welche unauflöslich miteinander verbunden sind« (Rosa 187). Emotionen sind nämlich nicht einfach Gefühle, mit denen jede*r für sich allein fertig werden muss. Das trifft auch auf Ängste zu. In der Auseinandersetzung mit ihnen wird vielmehr etwas über die eigene Selbst- und Weltbeziehung deutlich – in ihnen steckt eben »ein anderer Bezug zur Realität und ein viel größerer Erkenntniswert […], als gemeinhin angenommen wird« (Englert 279).
Eine kleine Kartografie der Angst
Natürlich: Sich im Dunkeln zu fürchten, ist ein ›Angst-Klassiker‹ einer bestimmten Entwicklungsphase. Und dennoch ist es ratsam, nicht zu zeitlos über Ängste zu denken. Es kann hilfreich sein, sich zu vergegenwärtigen, dass das, wovor Menschen sich fürchten, (nicht nur) genetisch bestimmt, sondern vor allem sozial erlernt ist. Von daher ist es wichtig zu fragen, welche Ängste eine bestimmte Zeit beherrschen und wie diese auf die Schüler*innen einwirken; schließlich werden diese von ihnen (und natürlich auch den Lehrer*innen) an den Ort der Schule mitgebracht. In Suchprozessen kann versucht werden, bestimmte Angstformen wahrzunehmen, zu identifizieren und nach den Wurzeln dieser Ängste zu fragen. Dabei kann Schritt für Schritt so etwas wie eine Landkarte von Ängsten entstehen. Das kann schon ein erster Schritt sein, um Ängsten ihren Schrecken zu nehmen und nach Wegen zu suchen, wie diesen begegnet werden kann. Ich möchte exemplarisch zwei mögliche Ausgangspunkte für eine solche Kartografie von Ängsten charakterisieren.
1. Die Angst, nicht gut genug zu sein: Für den Soziologen Richard Sennett ist diese Angstform deswegen ›typisch modern‹, weil sie ein Kind unserer Zeit ist: Stetig mehr zu leisten, sich zu verbessern und zu optimieren – diese Imperative prägen die Moderne bis in ihre tiefsten kulturellen Strukturen. Sie beeinflussen, bewusst oder unbewusst, wie wir unser Leben wahrnehmen. Die Angst, nicht mehr mitzukommen und nicht gut genug zu sein, hat ihre Wurzeln in derjenigen kulturellen Atmosphäre, die bevorzugt jene ins Rampenlicht rückt, die immer höher, schneller und weiter als die anderen sind. Diese Angst kann sich vielfältig äußern, sie betrifft Kinder anders als Jugendliche und ebenso auch Erwachsene. Ein Beispiel? Die elterlichen Sorgen um die ›Wettbewerbsfähigkeit‹ ihrer Kinder: »Kaum sind diese geboren, setzt (…) eine geradezu erbarmungslose Förderung ihrer physischen, psychischen, musischen, kreativen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten ein, und die meisten Eltern kennen nur eine Angst: Das Kind könnte in irgendeiner Hinsicht zurückgeblieben sein oder Defizite haben; und umgekehrt kennen sie nur einen Stolz: Mein Kind ist, gemessen an seinem Alter, schon weiter, als zu erwarten war« (Rosa 622).
Welche Ängste beherrschen eine bestimmte Zeit?
2. Der Blick der Medusa und die Frage nach Wirkungen von Ängsten: Angst beginnt oft dort, wo Halt und Orientierung gebende Strukturen wegbrechen oder nicht vorhanden sind. Ähnlich wie Traurigkeit hat auch Angst eine paralysierende Wirkmacht: Sie ›versteinert‹ Menschen. Angst steht in Beziehung mit Gefühlen von Ungewissheit, Unsicherheit und der tiefgehenden Hilflosigkeit, wie dies auch Freud in seiner ersten Theorie über die Angst als wesentliches Merkmal bestimmt. Diese Unsicherheit und Hilflosigkeit in der Etablierung von Weltbeziehungen ist heute deutlich spürbar – gerade für junge Menschen kann die »verwundete Welt« (Gärtner) leicht wie eine tickende Zeitbombe erscheinen, von der man überfordert wird. Wie soll man den überkomplexen Problemen dieser Welt noch begegnen? Wo eine solche Hilflosigkeit erfahren wird, kann ein Rückzug aus der Welt die Folge sein – und den Menschen auf das eigene Selbst zurückwerfen. Sichtbar wird hierbei die asoziale Seite der Angst, worauf die Philosophin Martha Nussbaum hinweist: »Angst ist in der Tat sehr narzisstisch. Sie vertreibt alle Gedanken an andere « (Nussbaum 49).
Diese beiden Punkte können erste ›Wegmarken‹ darstellen, von denen her weiter nach Formen, Umgangsweisen und Wirkmächten von und mit Ängsten Ausschau gehalten werden kann. Damit entsteht eine Karte, wo das Erfahrungsfeld der Angst von Schüler*innen und Lehrer*innen wahrgenommen, reflektiert, kritisiert, geprüft und problematisiert wird.
Mögliche Umgangsformen mit Angst – im RU
Religiöse Bildung hat die großartige Möglichkeit, die oben skizzierte Kartografie durch ein Nachspüren und Zur-Sprache-Bringen der Ängste (oder auch dem Mut!) biblischer Frauen- und Männergestalten zu bereichern. Die biblischen Narrationen können dabei für Schüler* innen zu einer wichtigen ästhetischen und symbolischen, zum Denken und Fühlen anregenden Ressource werden. Mit diesen Erzählungen zu arbeiten muss nicht ›peinlich‹ werden, weil es keinen Zwang gibt, sich in Bezug auf Ängste »selbst ›outen‹ zu müssen« (Naurath 214) – und doch viel über Ängste (und mehr oder weniger hilfreiche Umgangsweisen damit) lernen zu können.
Gleichzeitig kann das Sprechen und Denken über Ängste theologisch begleitet werden. Dabei mag die Versuchung groß sein, Religionen als sicheren Hafen gegen die angstverursachenden Stürme der jeweiligen Zeit in Stellung zu bringen. Das Versprechen letzter Sicherheiten kann jedoch schnell zu einer Vertröstung werden, welche die realen Ängste nicht bearbeitet, sondern verdrängt. Die biblische Verheißung besteht jedoch nicht in einem (oft billigen) ›Alles wird schon gut werden‹, sondern in einem Fürchtet euch nicht. Das ist ein wesentlicher Unterschied: Das ›Fürchtet euch nicht‹ anerkennt, dass es hier eine Angst gibt – und dass diese »zur Existenz als solcher gehört« (Tillich 38). Gleichzeitig ruft es dazu auf, sich von dieser Furcht nicht paralysieren zu lassen. Stattdessen geht die biblische Botschaft – mit Paul Tillich gesprochen – eher in die Richtung, so etwas wie einen »Mut zum Sein« zu entwickeln. Dazu wäre vieles zu sagen, bspw. etwa, dass dieser sowohl den Mut, ein*e Einzelne*r zu sein umfasst als auch den Mut, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Warum – und wie geht das beides zusammen? Über solche Grundfragen der Angst zu philosophieren und zu theologisieren, hat m. E. eine wichtige Bedeutung für junge Menschen, um nicht denen ausgeliefert zu sein, die aus politischen Motiven Angst und Schrecken verbreiten.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unsere neue Dienstleistung für Verlage, die ihr Abogeschäft in gute Hände geben wollen.
|

mehr
Informationen
|
 |
|
| Bücher & mehr |

|
|