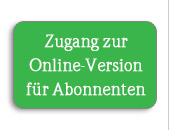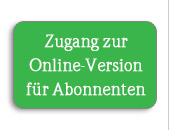archivierte
Ausgabe 5/2025 |

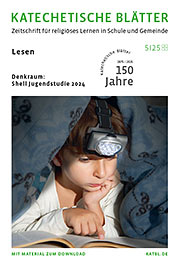
 |
       |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| Markus Pissarek |
| Förderung der Lesekompetenz |
| Lesekompetenz und wirksame Fördermaßnahmen sind so gut erforscht wie noch nie – und dennoch gibt es große Herausforderungen in der schulischen Leseförderung zu bewältigen. |
 |
Wie bedeutsam eine ausreichend entwickelte Lesekompetenz ist, ist inzwischen eine Art Gemeinplatz geworden. Die PISA-Studien haben dazu geführt, dass wir uns weit genauer und empirischer der Frage stellen, was Lesekompetenz ist, wie man sie ermitteln kann und warum wir in Deutschland nicht die Ziele erreichen, die wir eigentlich für selbstverständlich halten. Lesen ist weit mehr als das fehlerfreie Entziffern von Buchstaben und Wörtern. Lesekompetenz umfasst nicht nur die Fähigkeit, Texte korrekt zu dekodieren, sondern vor allem, sie zu verstehen, zu reflektieren und im sozialen und persönlichen Handeln nutzbar zu machen – symbolische und metaphorische Bedeutungsebenen ins Lesen einzubeziehen und mit textsortenspezifischen Darstellungsstrategien gekonnt umzugehen. Dabei Freude und Genuss zu empfinden, ist keine Selbstverständlichkeit und sehr individuell.
Fachdidaktische Lesekompetenzmodelle
In der Deutschdidaktik hat sich längst ein erweitertes Verständnis etabliert: Lesekompetenz ist eine mehrdimensionale Fähigkeit, die sich aus kognitiven, motivationalen und sozialen Teilprozessen zusammensetzt. Während internationale Studien wie PISA Lesekompetenz gemäß dem Literacy-Begriff häufig als »life skill« operationalisieren – also als Schlüsselkompetenz für gesellschaftliche Teilhabe –, zielt die deutschdidaktische Perspektive auf ein breiteres Begriffsverständnis. Sie fragt nicht nur danach, wie »Informationsentnahme « gelingt, und reduziert nicht auf kognitive Teilleistungen, sondern betrachtet auch, welche Rolle die soziale Einbindung des Lesens spielt und wie es um das Selbstkonzept der Lernenden und ihren Wegen zu stabilen, genussvollen Leserinnen und Lesern bestellt ist.
Hilfreich ist hier die Orientierung an fachdidaktischen Modellen, die Lesekompetenz auf mehreren Ebenen beschreiben, wie das populäre Mehrebenenmodell von Rosebrock & Nix (2025):
- Auf der Prozessebene geht es um die Fähigkeiten Wort- und Satzidentifikation, lokale und globale Kohärenzbildung, Erkennen von Superstrukturen und Identifikation von Darstellungsstrategien.
- Auf der Subjektebene spielen Lesemotivation, Selbstkonzept als (Nicht-)Leserin/Leser, Beteiligung und Reflexion eine zentrale Rolle.
- Die soziale Ebene schließlich berücksichtigt den Einfluss von Familie, Schule, Peers und kulturellem Kontext – einschließlich der zentralen Anschlusskommunikation über Gelesenes.
Lesen ist dabei grundsätzlich kein rein mechanisches, reproduzierbares Vorgehen, sondern ein höchst individueller, interaktiver und komplexer Konstruktionsprozess. Es handelt sich um einen inneren Dialog von Leserin bzw. Leser und Text, bei dem aus kognitionspsychologischer Sicht ein sogenanntes mentales Modell des Textes aufgebaut wird, wobei bottom-upund top-down-Prozesse ineinandergreifen – also die Textdaten und die Vorwissensbestände des Lesers bzw. der Leserin.
Vom Modell zur Förderung der Lesekompetenz
Solche Modelle sind nicht nur theoretisch gehaltvoll, sondern vor allem praktisch anschlussfähig: Sie helfen Lehrkräften dabei, Lernausgangslagen besser zu erfassen und passgenaue Fördermaßnahmen zu entwickeln. Eine adaptive, passgenaue Leseförderung ist weit wirksamer und erfolgreicher als ein breit konzipierter Leseunterricht, der ohne Diagnostik und informierte Differenzierung gestaltet wird. Die Unterschiede sind dramatisch und können – bezogen auf einzelne Lesefördertrainings – fundamentale Effektstärkenunterschiede erklären. Diese Effektstärkenunterschiede können als eine Diskrepanz in den Entwicklungen von mehreren Schuljahren übersetzt werden – die Entscheidungen der Lehrkräfte machen einen großen Unterschied. Es ist beispielsweise nicht sinnvoll, Lesenächte oder andere Verfahren der Leseanimation durchzuführen (das sind Maßnahmen, die auf die »Subjektebene« und die »soziale Ebene« zielen), wenn die Schülerinnen und Schüler noch nicht die Voraussetzungen dafür erfüllen. Diese Voraussetzung ist u. a. eine ausreichende Leseflüssigkeit, erst dann kann sich genussvolles Lesen entwickeln. Leseflüssigkeit kann wiederum mit informeller Diagnostik – z. B. in Form von Lautleseprotokollen – bestimmt und im Sinne einer Lernverlaufsdiagnostik erhoben werden. Sie umfasst zumindest Lesegeschwindigkeit (Wörter/ Minute), Dekodiergenauigkeit (Anteil der korrekt vorgelesenen Wörter zu den Gesamtwörtern in %), Prosodie (Satzmelodie, Betonung, Phrasierung usf.) und Automatisierung. Wird dies nicht beachtet, haben Studien sogar gezeigt, dass gut gemeinte Fördermaßnahmen gegenteilige Effekte erzielen können und Kinder beispielsweise ihr Selbstkonzept als Nicht-Leserin bzw. Nicht-Leser noch weiter verstärken als abbauen. [...]
Lesen Sie den kompletten Artikel in der Printausgabe oder in der Online-Version.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unsere neue Dienstleistung für Verlage, die ihr Abogeschäft in gute Hände geben wollen.
|

mehr
Informationen
|
 |
|
| Bücher & mehr |

|
|