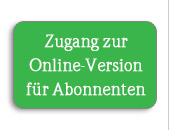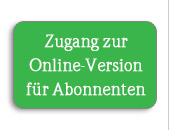»Wieder neuer Tag in Babylon (pow, pow) / Döner, Ayran, Shotgun, Beifahrer / Stinkt wieder nach Weed und alle fragen sich, warum (sag, warum?) / Weil 187 hat die Party übernommen. «
Diese Zeilen stammen aus dem Hook des (ansonsten eher generischen) Tracks »Babylon« der Deutsch-Rapper Bonez MC und Gzuz aus dem Jahr 2023. Sie sind ein Beispiel dafür, dass die Rede von »Babel« oder »Babylon« auch in der spätmodernen Popkultur noch anschlussfähig ist. Im Zentrum stehen dabei allerdings nicht der Turmbau als Ausdruck menschlicher Hybris oder die Sprachverwirrung als göttliche Bestrafung, sondern ein fast lustvoller Blick auf Multikulturalität, Genuss, Gesetzlosigkeit, Freiheit und Zusammenhalt.
»Babel«: Kulturelle Resonanzräume
Die Liste kultureller Verarbeitungen lässt sich fast beliebig erweitern. Aktuelle Resonanzen von Babel reichen von der erfolgreichen Fernsehserie »Babylon Berlin«, die Millionen von Zuschauer*innen erreicht hat, über den prominent besetzten Episodenfilm »Babel«, der menschliche Nöte in ihrer globalen Verflechtung in den Blick nimmt, bis zum deutschen Psychodrama »Freiheit«, in dem der Turmbau zu Babel ein zentrales Motiv darstellt. Dabei setzen die drei filmischen Adaptationen in Form und Inhalt durchaus unterschiedliche Akzente im Umgang mit der Babel-Geschichte: Im Spielfilm »Freiheit« wird die Geschichte sozusagen ›über Bande‹ über das Gemälde »Der Turmbau zu Babel« des niederländischen Renaissancemalers Pieter Bruegel eingebracht. Im Fokus steht die existenzielle Erfahrung der Fragmentierung des spätmodernen Subjekts. Im Film »Babel« wird der Bezug im Titel prominent angezeigt und durch die grenzüberschreitende Verknüpfung der Handlungsstränge ausbuchstabiert. Im Unterschied dazu basiert »Babylon Berlin« auf dem apokalyptischen Bild von der Großstadt als Schauplatz von Anomie und moralischem Verfall (vgl. auch den Beitrag von Martin Ostermann in diesem Heft).
Zugleich lassen sich Gemeinsamkeiten erkennen: So scheint der gemeinsame populärkulturelle Resonanzraum der Chiffre Babel in Assoziationen von Mobilität, Freiheit, Freizügigkeit und Grenzerfahrungen zu liegen. Außerdem wird die transzendente Dimension des Babel-Motivs vollständig ausgeblendet: Das göttliche Strafgericht entfällt, der Akzent liegt auf dem einzelnen Menschen als Träger von Agency, aber auch als Gegenstand von Zerrüttung und Zersplitterung. In dieser Hinsicht ähnelt der Umgang mit der Babel-Erzählung der modernen Apokalyptik (Nagel 168–172). Allerdings scheint es, anders als bei anderen biblischen Bezügen wie »Wunder« (Religion unterrichten 1/2021) oder »Teufel« (Katechetische Blätter 2/2024), keinen kulturwissenschaftlichen oder religionspädagogischen Forschungsstand zur kulturellen Adaptation des Babel-Motivs zu geben.
Aus religionswissenschaftlicher Sicht fließen im populärkulturellen Resonanzraum zwei unterschiedliche Babel-Diskurse zusammen: Erstens, ein apokalyptischer Diskurs, der an die Figur der »Hure Babylon« in Offb 14,8 anknüpft und die moderne Großstadt als Moloch von Sittenverfall und Zügellosigkeit imaginiert. Und zweitens, ein Diaspo-ra-Diskurs, der die Erzählung der babylonischen Gefangenschaft aufnimmt und an Er-fahrungsräume von Exil und Bedrückung anschließt. Im Folgenden möchte ich mich auf diesen zweiten Diskursstrang konzentrieren und einen Blick in die sozialwissenschaftli-che Diaspora-Forschung werfen. Hier wird Babel nicht nur als Stätte von Unterdrückung, sondern auch als eine Art postmigrantischer Raum und Forum interkultureller und interre-ligiöser Kreativität verhandelt.
»Babel« als »Gewächshaus« für religiöse Innovation
Dies ist nicht der Ort, um einen ausführlichen Überblick über die Diaspora-Studies zu geben (vgl. dazu Baumann/Nagel Kapitel 2). Daher nur so viel: Es handelt sich um ein sozial- und kulturwissenschaftliches Forschungsprogramm, das Minderheiten in ihrer globalen Verflechtung und lokalen Einbettung in den Blick nimmt. Wie der Name schon sagt, bildet die biblische »Diaspora«, also die Babylonische Gefangenschaft, hier ge-wissermaßen den Prototyp, von dem ausgehend allgemeine Merkmale der Mehr-heit-Minderheiten-Konstellation unterschieden werden.
[...]