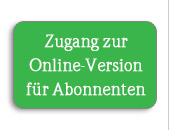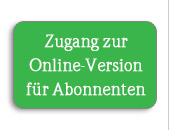archivierte
Ausgabe 3/2025 |

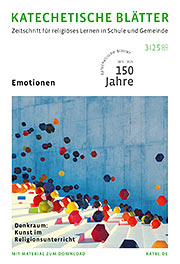
 |
       |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| Helga Kohler-Spiegel |
| »Heute bin ich …« – Emotionen lernen in der Grundschule |
| Emotionale und soziale Kompetenzen haben zentrale Bedeutung für die Lebensgestaltung. Emotionale Kompetenz als Fähigkeit, mit den eigenen und den Emotionen anderer umzugehen, bildet die Basis für soziale Kompetenzen ( Valentien 2022, 6–7). Das Ziel, Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung zu fördern und zu begleiten, ist eine bedeutsame Aufgabe schulischen Lernens. |
 |
Nun denn. Es ist Montagmorgen, eine vermutlich ziemlich »normale« Grundschule, eine zweite Klasse, die Vielfalt an Familiensprachen, an Religionen und nationaler Zughörigkeit ist groß. Ein Kind weint, es gab viel Streit am Sonntag, ein Kind will unbedingt von Kaninchen erzählen, ein Kind spricht nicht, zwei suchen Körperkontakt zur Lehrerin, einige Kinder fallen durch unruhige Bewegungen, Aufstehen, Herumgehen und Herausrufen auf. Disziplinare Anweisungen verpuffen in der Unruhe.
Ein Baby lernt emotional, empfangene Signale aufzunehmen und durch Imitation zurückzuspiegeln.
Und dann: Die Lehrerin, jetzt für Religion, schaut jedes Kind an und nimmt eine Melodie auf, die zu einem Lied führt, sie verbindet das Lied mit Klatsch-Bewegungen in die Hände, auf die Oberarme, die Oberschenkel. Es dauert, bei der zweiten Wiederholung sind bereits zahlreiche Kinder mit dabei, am Ende singen alle. Es sind alle angekommen, der Unterricht kann beginnen.
1. Entwicklung des emotionalen Lernens
Zu Beginn des Lebens geschieht Wichtiges. Stellen Sie sich vor: Sie tragen ein Baby auf dem Arm, Sie lächeln das Kind an, das Kind nimmt Ihre Gesichtszüge wahr, es nimmt diese auf und lächelt zurück. Sie lächeln wieder und verknüpfen das Lächeln mit Worten, vielleicht mit einem Summen, einer Melodie. Das Kind nimmt zu den Gesichtszügen den Klang Ihrer Stimme auf, es reagiert mit seinen Möglichkeiten, immer in Resonanz zu Ihrem Ausdruck. Für menschliches Lernen sind diese Erfahrungen zentral. Denn das Baby lernt dadurch auf kognitiver Ebene, dass sein Verhalten eine Reaktion bei seiner Bezugsperson verursacht und es mit seinem Tun etwas bewirken kann. Es lernt emotional, empfangene Signale aufzunehmen und durch Imitation zurückzuspiegeln. Es lernt, dass die Bezugsperson ihre Reaktion auf den Erregungszustand des Babys abstimmt und diesen reguliert. Kleinkinder lernen auf diese Weise, dass Gefühle in Beziehungen wichtig sind und dass es möglich ist, dass andere meine Gefühle und ich deren Gefühle verstehen kann (Kohler-Spiegel 2022, 115 ff).
Emotionale Entwicklung ist verbunden mit sozialer Entwicklung, denn »Gefühle haben ihre Wurzeln im sozialen Diskurs, in früheren Beziehungen und vielleicht sogar in der Konstruktion des Selbst« (Saarni 3). Das Sprechen über Gefühle erweitert die Möglichkeit, Wissen über Auslöser von Emotionen aufzubauen und dieses Wissen auf neue Situationen anzuwenden. Indem Kinder lernen, welche Situationen bei ihnen welche Gefühle hervorrufen, entwickeln sie auch ein Verständnis für die Emotionen anderer. So werden Empathie und prosoziales Verhalten entwickelt.
2. Empathie lernen
Der Terminus »Gefühlsansteckung« geht auf Max Scheler (1923) zurück, 1994 übernahm ihn Elaine Hatfield (1994), er beschreibt die angeborene Fähigkeit des Menschen, dass Gefühle einer Person bei anderen Menschen unwillentlich Imitationen auslösen können, deshalb ist von »Ansteckung« die Rede.
In Unterscheidung dazu ist Empathie die Fähigkeit, Emotionen und Absichten einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und darauf zu reagieren. Empathie erfordert und ermöglicht, zwischen eigenen Emotionen und denen anderer Menschen zu differenzieren und zugleich eine menschliche Ähnlichkeit zu entdecken. Es wird zwischen kognitiver, emotionaler und sozialer Empathie unterschieden. Empathie umfasst die Fähigkeit zu verstehen, was ich durch mein Verhalten bei anderen auslöse, und was andere denken und fühlen (Bischof- Köhler).
3. Emotionale Kompetenz im Kontext schulischen Lernens
Ein gelungenes Konzept emotionaler Kompetenz zielt auf die »Entwicklung einer balancierten Persönlichkeit, das den Erwerb von Beziehungsfähigkeit, Bewältigungskompetenzen und Fähigkeiten zur Selbstregulation einschließt « (Salisch X). Saarni listet acht Aspekte emotionaler Kompetenz auf, die Reihenfolge ist offen, Ergänzungen sind möglich:
1. Sich über den eigenen emotionalen Zustand bewusst zu sein
2. Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen eines bestimmten kulturellen Rahmens zu deuten
3. Die Fähigkeit zum Gebrauch des Emotionslexikons, d. h. die Fähigkeit, Emotionen präzise auszudrücken
4. Die Fähigkeit zur empathischen Anteilnahme
5. Die Fähigkeit, das Ausdrucksverhalten vom inneren emotionalen Zustand zu differenzieren
6. Die Fähigkeit, belastende Emotionen mit einem Repertoire von Bewältigungsstrategien auszugleichen
7. Das Bewusstsein, dass zwischenmenschliche Beziehungen davon abhängig sind, dass Gefühle und der Ausdruck dazu ehrlich sind
8. Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit (Saarni 13; Valentien 6; Naurath 200) [...]
Lesen Sie den kompletten Artikel in der Printausgabe oder in der Online-Version.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unsere neue Dienstleistung für Verlage, die ihr Abogeschäft in gute Hände geben wollen.
|

mehr
Informationen
|
 |
|
| Bücher & mehr |

|
|