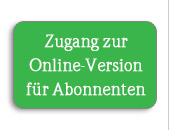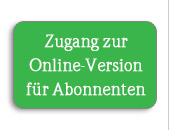archivierte
Ausgabe 4/2025 |

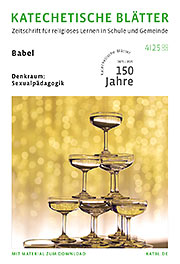
 |
       |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| Stefan Altmeyer / Lukas Ricken |
| Babel als Denkfigur für ein Leben jenseits klarer Ordnungen |
| »Babel« ist mehr als ein gescheitertes Bauprojekt oder eine leicht zu entschlüsselnde Parabel über menschlichen Größenwahn. Als zentrale biblische und (pop)kulturelle Metapher eröffnet es Prozesse der Auseinandersetzung über Vielstimmigkeit, Fortschritt und deren Fragilität. |
 |
 |
|
»Menschen müssen lange Zeit viel Wasser trinken, da dies wichtig ist.« So lautet das Ergebnis eines Sprachexperiments mit Mainzer Theologiestudierenden. Diese sollten spontan und in einem Satz die Kernbotschaft der Erzählung vom Turmbau zu Babel (Gen 11,1–9) notieren. Sie sollten dabei weder analysieren noch nacherzählen, sondern einfach ihre persönliche theologische Einsicht formulieren.
Es folgte das eigentliche Experiment: eine Übersetzungskette. Die Ausgangssätze wurden mit einer Übersetzer-App Schritt für Schritt in mehrere Sprachen übertragen: von Deutsch nach Bosnisch, dann weiter über Estnisch, Griechisch und Igbo zurück ins Deutsche. Tatsächlich waren dies alles Sprachen, mit denen die Gruppe schon einmal in Kontakt gekommen war. Nach vier Stationen stand jener Satz da, dessen Bezug zur Babel-Erzählung kaum mehr zu rekonstruieren sein dürfte.
Sprachverwirrung durch Bedeutungsverschiebungen
Die Übersetzungskette veranschaulicht auf einfache Weise, was in der Translationswissenschaft als semantic oder translational shift bezeichnet wird. Gemeint sind Bedeutungsverschiebungen, die bei Übersetzungen zwangsläufig auftreten, gerade auch dann, wenn KI-Sprachmodelle beteiligt sind. Dass diese Verschiebungen vor allem bei mehreren aufeinanderfolgenden Übersetzungen entstehen, macht der Spielklassiker »Stille Post« erlebbar. So ist das hier vorgestellte Experiment auch von diesem Spiel inspiriert, ähnlich wie es Alexander- Kenneth Nagel in seinem Beitrag zu diesem Heft vorschlägt.
Beide Beispiele mit oder ohne KI zeigen: Kommunikation ist störungsanfällig – nicht nur, aber besonders unter komplexen sprachlichen Bedingungen. Manchmal lässt sich darüber lachen, manchmal führt es zu Verwirrung. Häufig jedoch werden kommunikative Brüche zum Ausgangspunkt für Missverständnisse, Irritationen oder auch für ernste Konflikte. Womit wir beim Thema dieses Heftes wären.
Babel: Sprache zwischen Geschenk und Bürde
Die biblische Erzählung vom Turmbau wird oft als Episode über menschliche Hybris gelesen, an deren Ende die vielen Sprachen stehen. So lautete auch eine typische Formulierung der Studierenden: »Der Mensch soll sich nicht zum Gott erhöhen.« Eine Aussage übrigens, die das Übersetzungsexperiment mit einem bemerkenswerten Perspektivenwechsel überstanden hat: »Die Menschen sollten nicht über die Grenzen Gottes hinausgehen.«
Doch ob man nun das menschliche Aufwärtsstreben oder die von Gott gesetzten Grenzen betont, ein Blick in den Text der Urgeschichte zeigt: Ganz so eindeutig ist die Lage nicht. Wie Egbert Ballhorn in seinem Beitrag aufzeigt – und wie Paula Schöttke sowie Eva Stögbauer-Elsner und Michaela Gilhuber didaktisch aufgreifen –, ist in Gen 11,1–9 weder von Sünde noch ausdrücklich von Strafe die Rede. Der Turm stürzt auch nicht in einer großen Katastrophe in sich zusammen oder wird aktiv zerstört. Die Baustelle bleibt einfach stehen, weil sich die Leute nicht mehr verständigen können.
Damit wird von einem Eingreifen Gottes erzählt, das die anfangs einheitliche Sprache in eine Vielfalt umwandelt und damit das Entstehen eines totalitären Projekts unterbricht: eine riesige Stadt, ein himmelhoher Turm, ein großer Name, eine Sprache für alle – eine eindeutige Ordnung. [...]
Lesen Sie den kompletten Artikel in der Printausgabe oder in der Online-Version.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unsere neue Dienstleistung für Verlage, die ihr Abogeschäft in gute Hände geben wollen.
|

mehr
Informationen
|
 |
|
| Bücher & mehr |

|
|